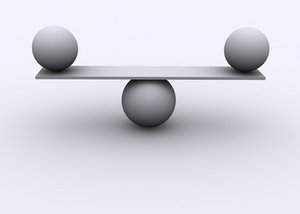Belastende Erfahrungen in der frühen Kindheit, wie beispielsweise eine gestörte Eltern-Kind-Bindung, gelten als Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter. Die zugrundeliegenden neurobiologischen Mechanismen sind jedoch bisher nicht hinreichend geklärt. Ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftler:innen der Universitätsmedizin Mainz hat in einem Mausmodell gezeigt, dass frühkindliche Stresserfahrungen die Funktion von bestimmten Gehirnzellen, den sogenannten NG2+-Gliazellen, langanhaltend beeinträchtigen können (siehe Neurobiology of Stress, Band 15, Nov. 2021). Diese neue Erkenntnis ist Grundlage für die Entwicklung neuer Therapieansätze bei stressbedingten psychischen Störungen wie der Depression.
Das menschliche Gehirn besteht etwa zur Hälfte aus Gliazellen. Dabei handelt es sich um Zellen im Nervengewebe, die zusammen mit den Nervenzellen (Neuronen) das Nervensystem bilden. Die bisherige neurobiologische Forschung zu den Ursachen und Therapien von psychischen Erkrankungen konzentrierte sich vor allem auf die Nervenzellen.
„Es wurde lange übersehen, dass die Gliazellen nicht nur das neuronale Netzwerk stützen, sondern auch Signale senden und mit den Neuronen kommunizieren. Das Hauptziel unserer Untersuchungen war es daher, nun erstmals die molekularen und funktionellen Auswirkungen von frühkindlichem Stress auf eine bestimmte Gliazellpopulation, die Oligodendrozyten-Vorläuferzellen, auch bekannt als NG2+-Zellen, zu charakterisieren“, erklärt PhD Giulia Treccani, Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Mikroskopische Anatomie und Neurobiologie (IMAN) der Universitätsmedizin Mainz und Erstautorin der Studie. „Wir wollten verstehen, inwieweit Stress in der frühen Kindheit die NG2+-Zellen und ihre Funktion beeinflusst und wie diese Veränderungen zu langanhaltenden negativen gesundheitlichen Folgen im späteren Leben führen können.“
Die Studienergebnisse zeigen, dass die Kommunikation zwischen NG2+-Zellen und Neuronen bei stressbedingten Störungen von großer Bedeutung ist, wobei spannungsgesteuerte Natriumkanäle eine wichtige Rolle spielen. Dies ermöglicht neue Einblicke in die Pathophysiologie von frühkindlichem Stress. „Wir haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der Stress-assoziierten psychischen Erkrankungen wie der Depression zugrunde liegt. Insbesondere die Idee, dass wir durch die Modulation spannungsgesteuerter Natriumkanäle die Netzwerkaktivität wieder ins Gleichgewicht bringen und somit die regelrechte Funktion des Gehirns wiederherstellen können, birgt ein großes Potential für die Entwicklung neuartiger therapeutischer Ansätze in der Zukunft“, betont Treccani.
Quelle: Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz